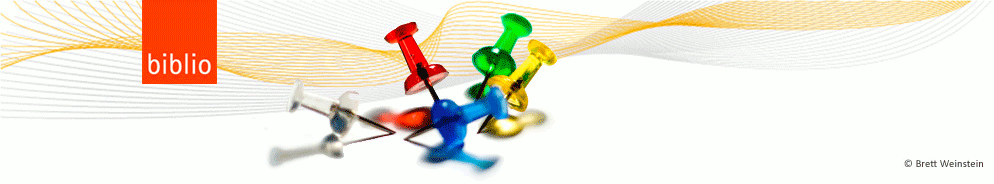Gedenktag zur Salzburger Bücherverbrennung
Am 30. April 1938 fand am Salzburger Residenzplatz die einzige von den Nationalsozialisten in Österreich veranstaltete Bücherverbrennung statt. Zum Gedenktag dieses Ereignisses vor 75 Jahren stellten die Universität, Autorenverbände und engagierte Menschen eine Veranstaltung gegen das Vergessen auf die Beine. Der erste Teil dieses Erinnerungstages stand ganz im Zeichen des öffentlichen Auftretens von Schülern und Studenten gegen Intoleranz, Zensur und der Einschränkung der Meinungs – und Pressefreiheit. So begann die Veranstaltung mit einer Menschenkette zwischen Universitätsbibliothek und dem Residenzplatz. Schließlich präsentierten die jungen Leute Musik und Texte zum Thema Bücherverbrennung.
Die Schultheatergruppe der BAKIP Salzburg spielte Schlüsselszenen aus Jura Soyfers Stück Der Weltuntergang oder Die Welt steht auf kein’ Fall mehr lang. Es zeigt die Menschheit vor der drohenden Apokalypse, der Zerstörung der Welt durch einen Kometen. Jura Soyfer wäre heuer 100 Jahre alt geworden. Er starb 1939 im KZ Buchenwald.
Besonders auch Salzburger Autoren gab diese Gedenkfeier Anlass eigene Texte vorzulesen. Leser, Musiker und Zuhörer versammelten sich in der Michaelskirche am Residenzplatz. Eine Aktion dieser Art gibt es seit April 1987, wo der Dichter Erich Fried zum Gedenken an die Salzburger Bücherverbrennung auftrat. In seiner Rede formulierte er damals den Satz, dass es nicht genüge die Bücherverbrennung zu verdammen, ohne für die Freiheit des Wortes zu kämpfen. Es sei eine Initiative gegen das “öffentliche Schweigen”, charakterisiert der Germanist Karl Müller die Veranstaltungsreihe. Es habe bis 1987 gedauert, bis sich in Salzburg überhaupt irgendjemand an den barbarischen Akt der Nationalsozialisten erinnern wollte.
Eine der Hauptrednerinnen, nämlich die Journalistin und Standard-Kolumnistin Barbara Coudenhove-Kalergi, erwähnte auch, dass sie gegen die reine Gedenkveranstaltung ein bisschen skeptisch sei, wenn diese eine Fleißaufgabe des schlechten Gewissens wäre. Den Antisemitismus, der bei der Bücherverbrennung eine große Rolle gespielt habe, hält Coudenhove-Kalergi zwar nicht mehr so ausschlaggebend, wohl aber tritt Fremdenfeindlichkeit heute in einem anderen Gewand wieder auf: Man bekomme zwar nicht mehr “Saujud” zu hören, dafür aber sehr wohl “Scheißtürke” oder “Scheißtschusch”. Für Coudenhove-Kalergi ist ins besonders der Antiislamismus der Antisemitismus des 21. Jahrhunderts. Damit könne man heute, so wie damals, wieder Politik machen.
Auch der österreichische Dramatiker, Autor und Schauspieler Felix Mitterer hielt eine Lesung und einleitende Worte gab es vom Präsident der israelitischen Kultusgemeinde Salzburgs Marko Feingold. Die Gedenkveranstaltung Dienstagabend war mit etwa 500 Teilnehmern wesentlich besser besucht als jene vor 25 Jahren. Unter den Besuchern unter anderen auch Erzbischof Alois Kothgasser und Landeshauptfrau Gabi Burgstaller.