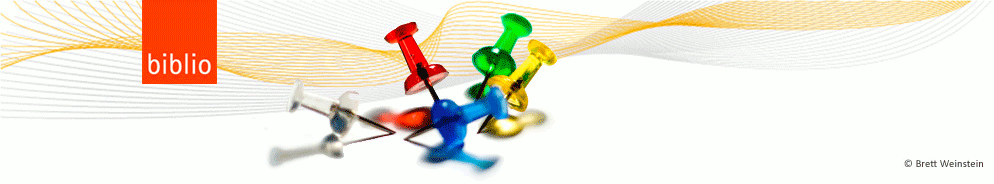Michael Stavarič – Adelbert-von-Chamisso-Preis 2012
Viele Kulturen – eine Sprache
: Adelbert-von-Chamisso-Preis 2012 der Robert Bosch Stiftung
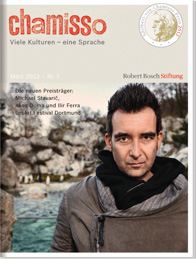 Dieser seit 1985 existierende Literaturpreis zeichnet das deutschsprachige, bereits publizierte Werk von AutorInnen aus, die nichtdeutscher Sprachherkunft sind, wie es auch Adelbert von Chamisso selbst war. Die Dotierung des Hauptpreises beträgt 15.000 Euro. Daneben werden bis zu zwei Förderpreise mit einer Dotierung von jeweils 7.000 Euro vergeben, die auch für unveröffentlichte Texte verliehen werden.
Dieser seit 1985 existierende Literaturpreis zeichnet das deutschsprachige, bereits publizierte Werk von AutorInnen aus, die nichtdeutscher Sprachherkunft sind, wie es auch Adelbert von Chamisso selbst war. Die Dotierung des Hauptpreises beträgt 15.000 Euro. Daneben werden bis zu zwei Förderpreise mit einer Dotierung von jeweils 7.000 Euro vergeben, die auch für unveröffentlichte Texte verliehen werden.
Nicht nur Offenheit gegenüber interkulturellen Begegnungen charakterisiert den Preis, sondern auch die kontinuierliche Begleitförderung der literarischen Aktivitäten der PreisträgerInnen durch die Stiftung ist vorbildlich und scheinbar einmalig. Mehr Informationen über den Preis, die PreisträgerInnen finden sich auf der Homepage der Robert Bosch Stiftung.
2012 wurde Michael Stavarič mit dieser hohen Auszeichnung bedacht. Der Autor wurde 1972 in Brno/Tschechien geboren, bereits mit sieben Jahren kam er nach Österreich. Später studierte er Bohemistik und Publizistik in Wien, wo er heute als freier Schriftsteller, Übersetzer, Kolumnist und Kritiker lebt. Seinen Durchbruch als Schriftsteller markieren die Romane „stillborn“ (2006) und „Terminifera“ (2007), für die er 2008 den Adelbert-von-Chamisso-Förderpreis erhielt. Es folgten u.a. „Magma“(2008), „Böse Spiele“(2009), „Brenntage“ (2011) und das Bestiarium „Nadelstreif und Tintenzisch“(2011).
Außerdem hat sich Michael Stavarič in den letzten Jahren als Autor von vielfach preisgekrönten Kinderbüchern einen Namen gemacht. Eine Reihe dieser Bücher sind mit der renommierten Illustratorin Renate Habinger entstanden, so auch das mit dem Österreichischen Kinder- und Jugendbuchpreis 2012 ausgezeichnete, im Residenz Verlag erschienene Bilderbuch „Hier gibt es Löwen“.
Rezensionen von Michael Stavarič auf rezenionen.online.open
„Literatur als Seismogramm einer unbekannten Zukunft“
Adelbert-von-Chamisso-Preisträger Michael Stavarič im Gespräch mit Elisabeth Zehetmayer
Elisabeth Zehetmayer: 2008 warst du Förderpreisträger des Adelbert-von-Chamisso-Preises. Was bedeutet für dich die diesjährige Auszeichnung mit dem Hauptpreis und die an den Preis geknüpfte „Nachbetreuung“ durch die Bosch-Stiftung?
Michael Stavarič: In erster Linie ist es eine große Überraschung gewesen, weil es nicht der Regelfall ist, dass ein Förderpreisträger auch den Hauptpreis bekommt. Der Förderpreis war für mich schon ein sehr sinnvoller Preis, da die Bosch-Stiftung im Anschluss Lesungen organisiert und als Ansprechpartner sowie für Pressekontakte zur Verfügung steht. Dies ist jetzt bei dem Hauptpreis wiederum der Fall und ich erhoffe mir davon ein nochmaliges Echo, sozusagen einen zweiten Frühling, für meinen Roman „Brenntage“ in Deutschland. Inwiefern ich dem Preis sonst gerecht werden kann, wird sich weisen.
Sobald man zu den Preisträgern gehört, ob Förder- oder Hauptpreisträger, ist man sozusagen Teil dieser großen „Bosch-Familie“, die sich dann regelmäßig nach Arbeitsfortgang und Wohlergehen erkundigt. Da steckt ein längerfristiges Konzept dahinter. Ich finde den Chamisso-Preis auch insofern sehr relevant, weil er der einzige Preis in dieser Dotation im deutschsprachigen Raum ist, der die Einflüsse anderer Sprachen auf das Deutsche im positiven Sinn ins Rampenlicht rückt und gleichzeitig die Frage stellt: Inwieweit bereichern andere Sprachen das Deutsche auf einer literarischen Ebene? Fraglos tun sie es in einem großen Maß und es ist in einem literarischen Sinne wichtig, weil das Deutsche dadurch neue Impulse erfahren kann. Die Liste der PreisträgerInnen veranschaulicht sehr deutlich diesen Bonus für die deutsche Sprache. Deshalb sollte es auch mehr Preise in dieser Richtung geben!
EZ: Betrachten deiner Ansicht nach AutorInnen mit einer anderen Muttersprache im Hintergrund die Welt „weitwinkliger“? Hat deine Biografie einen kreativen Effekt auf deine Literatur?
MS: Mehrsprachige AutorInnen haben, gerade wenn Flucht oder andere Migrationsgeschichten damit verbunden sind, meist eine wesentlich andere Biografie als deutschsprachige AutorInnen. Allerdings ist der Begriff „Migrationsliteratur“ für mich sehr zwiespältig, er rückt AutorInnen leicht in die Ecke des „braven Quotenmigranten“. Ich habe das selbst nicht erlebt, jedoch von anderen AutorInnen nichtdeutscher Muttersprache gehört.
Grundsätzlich bin ich davon überzeugt, dass auch jede andere schriftstellerische Biografie von Zäsuren und gewissen Initialereignissen geprägt ist, die einen prädestinieren, sich den Künsten zuzuwenden. Biografien, die etwas Ungewöhnliches aufweisen. Klarerweise stellt das Verlassen einer Sprachheimat und das sich andernorts Ansiedeln eine solche Zäsur dar.Von mir persönlich kann ich sagen, dass ich wohl nicht geschrieben hätte, wenn ich nicht ab dem siebten Lebensjahr mit dem Deutschen aufgewachsen wäre. Diese zwei Muttersprachen waren für mich sehr prägend. Ich habe unsere Flucht als eine Art Zäsur erlebt, die mich lange Zeit beschäftigt hat, auch wenn sie nicht in dem Sinne dramatisch war, dass sie unter lebensbedrohlichen Umständen erfolgt wäre. Da gibt es ganz andere Schicksale!
EZ: Wird für AutorInnen mit Migrationshintergrund die Eingliederung in den literarischen Betrieb immer schwieriger sein als für deutschsprachige KollegInnen?
MS: Sie haben es schwieriger, weil sie über eine ganz exzellente Sprache verfügen müssen und natürlich ist es ungleich schwerer, in einer Fremdsprache zu schreiben als in der Sprache, mit der man aufgewachsen ist. In dem Sinn sind sie bereits vom Start her benachteiligt. Doch wenn sie einen gewissen Sprachbereich erreichen, dann verfügen sie über mehr Möglichkeiten, das kann nur etwas Gutes bedeuten. Ansonsten schätze ich gerade in der österreichischen Literatur die Wahrnehmung eher als sehr homogen ein, es gibt hier genug SchriftstellerInnen, die schon vom Namen her arriviert sind und bei denen ganz klar ist, dass sie auch andere Wurzeln haben wie z. B. Julya Rabinowich, Dimitri Dinev, Vladimir Vertlib, etc. In Deutschland übernehmen diese Rolle eher die DDR-AutorInnen oder türkischstämmige AutorInnen wie Jakob Arjouni.
Für mich selbst ist das nicht die große Frage. Ich betrachte mich als jemand, der für eine gewisse Erneuerung in der Literatur steht, der dem Duktus der Zeit und diesem Zeitgeist, der in der Literatur herrscht, auch andere Ansätze entgegenbringt. Ich arbeite viel mit Sprache, Form, Metaphern und poetischen Bildern und trete für Sprachsensibilisierung ein, anstatt auf Knopfdruck das zu liefern, was mehr dem Zeitgeist entspricht. Vor allem interessiere und engagiere ich mich für die jüngeren AutorenkollegInnen, die auch in diese Richtung arbeiten, unabhängig davon, ob sie Migrationshintergrund haben oder nicht. Die Generationen unter 30 Jahren bzw. in den 30ern haben keine Migrationsschicksale im klassischen Sinne, aber es sind Generationen, die in einem grenzenlosen Europa aufwachsen, die viel mobiler sind, die einem in ganz Europa begegnen und die diesen Heimatbegriff, die Identitätsfrage ganz anders handhaben als noch AutorInnen vor 30-40 Jahren. Aufgrund dieser erhöhten Mobilität durch Schreibaufenthalte etc. fließen auch hier die verschiedensten Sprachen der verschiedenen Länder in ihre Werke ein.
EZ: In einem Artikel im „Standard“ im Jänner 2012 schreibst du über die zweifelhafte Entwicklung der Literatur. Wie siehst du die Zukunft der Literatur? Wird noch gelesen werden?
MS: Das war natürlich provokant formuliert. Es gibt genügend Leute, die anspruchsvolle Literatur lesen. Ich habe auch überhaupt nichts gegen Leute, die sehr gefällige Werke lesen. Das Lesen an sich ist wichtig! Die Fähigkeit, etwas auf diese Art und Weise wahrnehmen zu können, muss man auch beim Lesen von Unterhaltungsliteratur besitzen. Lesen bedeutet eine Art von Arbeitsaufwand. Selbst die platteste Form von Unterhaltungsliteratur beinhaltet den Aufwand, dass man Lesen muss. Man kann sich nicht einfach berieseln lassen wie im Film oder im Theater. Außerdem muss man die Geschichte im Kopf zusammenstecken, erst dann funktionieren auch diese Unterhaltungsbücher.
Lesen wird immer ein Bestandteil der menschlichen Kultur bleiben. Es ist auch nicht die Frage, wie gebildet oder nicht gebildet eine Leserin/ein Leser ist. Das Problem in der Belletristik liegt vor allem darin, dass die Mechanismen, die dieses oder jenes ermöglichen, umgestaltet werden. Wie in der Politik erfolgen Weichenstellungen, die ganz viele Dinge von vornherein ausschließen, sodass sie vielen Menschen schwer oder nur aufgrund großer Eigeninitiative zugänglich sind. Wenn ich den Buchhandel verkommen lasse, wenn die BuchhändlerInnen kein Grundbasiswissen, keine humanistische Bildung und keine Ahnung vom vorhandenen Sortiment mehr haben, dann wird es schwer, gewisse Titel zu verkaufen oder diese eigeninitiativ nachzubestellen. Der Buchhandel muss eigenständig agieren und reagieren! Sonst legen die großen Ketten fest, welche Titel eingekauft werden. Das reduziert sich dann auf ein paar große Verlage und kleinere, mittlere Verlage haben so gar keine Möglichkeit mehr, in den Buchhandel, in die großen Ketten zu kommen. Je weiter sich diese Entwicklung zuspitzt, umso düsterer wird dann aus meiner Warte der Buchmarkt, sofern nicht das E-Book oder ähnliche alternative Vertriebsstrukturen dem entgegenwirken.
Betrachtet man ausschließlich den Buchhandel und spinnt das so weiter, wird es irgendwann keine kleineren Buchhandlungen mehr geben, weil sie nicht überleben können, und die größeren werden alle dasselbe Sortiment aufweisen. Die zehn Toptitel der zehn großen Verlage, ein Gate-Keeping! Die Frage, ob es tatsächlich dem entspricht, was die Menschen gerne hätten oder nicht, ist dann nicht mehr relevant.
EZ: In „Brenntage“, dem mit dem Chamisso-Preis ausgezeichneten Roman, gibt es Szenen, Sätze und Liedzeilen, die den Untergang andeuten. Haben wir deiner Ansicht nach eine Zukunft oder sind wir alle dem Untergang geweiht? Steht eine Zeit des Übergangs bevor?
MS: Die Literatur ist, auf die Gesamtgesellschaft hin betrachtet, immer eine Art Sensorium – sie zeigt, was die Menschen gerade beschäftigt. In den letzten Jahren entstand sehr viel Literatur, die etwas Apokalyptisches in sich trägt, wie zum Beispiel T.C. Boyles kürzlich erschienener Untergangsroman. Das Thema ist offenbar auch bei den ganz Großen der Literatur angekommen und mehr als eine Modeerscheinung. Wir leben in einer Zeit großer Umbrüche, es geht um eine Neuausrichtung der Welt. Man kann das in den letzten zwanzig Jahren auch abseits der Literatur beobachten – im Bereich der Bionahrung zum Beispiel. Auch da ist heute klar, dass wir in einem Wandel leben und sich die Welt in den nächsten hundert Jahren ziemlich verändern wird. Genau diese Themen, die uns bewegen werden, greift die Literatur als eine Art Seismograph jetzt schon auf.
Die Zukunft wird gerne düster gemalt, weil sie etwas Unbekanntes ist. Das Unbekannte trägt immer eine Art von Bedrohung in sich. Letztendlich ist diese Neuausrichtung der Welt auch eine große Möglichkeit, das Leben anders zu begreifen. Ich finde es schön, wenn die Literatur eine Form von Zukunft zeigt, eine Art von Weissagung betreibt, die zu einer Auseinandersetzung damit führt. Ich habe das Gefühl, dass wir in einer solchen Zeit leben und dass dies unbedingt abgebildet werden muss. Erst wenn sich etwas ändert oder ich etwas anderes wahrzunehmen meine, kann ich andere Themen bearbeiten.
In den „Brenntagen“ konkret kann man sehen, was man will. Es schließen sich immer irgendwann die Kreise und es beginnen neue Kreise. Das ist unweigerlich mit der Welt verbunden. Wir leben in einer Zeit, wo ein Zyklus am Auslaufen ist. Wenn man die Geschichte der Menschheit betrachtet, dann ist das die normalste Sache der Welt. Reiche Staaten, Kulturen gehen unter, Neues entsteht. Daraus bezieht ja die Menschheit letztendlich ihre Kraft und Weisheit. Das ist alles nichts Schlechtes, auch der Tod ist nichts Schlechtes!
EZ: An den titelgebenden „Brenntagen“ entledigen sich die Menschen überflüssig gewordener Dinge, auch der Lasten ihrer Vergangenheit. Soll man sich überhaupt der Lasten seiner Vergangenheit entledigen?
MS: Wir alle sind auch ein Produkt unserer Geschichte, nicht nur unserer eigenen, sondern auch der Geschichte jener, die vor uns gelebt und dieses und jenes auf dem Gewissen, Dinge beeinflusst oder initialisiert haben. In den Brenntagen ist immer wieder die Initiation ganz wichtig. Ich glaube, man kann nicht ohne Vergangenheit leben, aber man sollte nicht in der Vergangenheit leben, man kann nicht ohne Zukunftsperspektiven leben. Man sollte sein Leben aber nicht nur der Zukunft widmen. Was uns alle prägt, ist der gegenwärtige, jetzige Moment. Das ist auch das Einzige, was jedes Individuum als Leben in sich empfindet, weil es das einzig Präsente ist und das maßgeblich alles Entscheidende. Das Leben in der Gegenwart, das Jetzt ist zweifelsohne das, worum es geht. Und das, wo man auch Akzente setzen kann, wo man das eine oder andere auch zum Besseren denken kann.