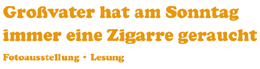|
Ein ABC der 50er und 60er Jahre
Einleitung zu den 50er/60er Jahren
Musik: „Die Liebe ist ein seltsames Spiel“
A
Auto
Waren Autos vor dem Krieg Luxusartikel, die nur den Superreichen vorbehalten
waren, so avancierte das eigene Auto Ende der 50er Jahre mit der Entwicklung
des Volkswagens „Käfer“ zum erfüllbaren Traum. Im
Dezember 1950 wurden in Österreich 48.453 PKWs registriert. Ende
1959 lagen bereits 348.852 Anmeldungen vor.
Antibabypille
1962 kam die Antibabypille in Deutschland auf den Markt – das war
der Startschuss für die legendäre sexuelle Revolution. In kürzester
Zeit galt vorehelicher Geschlechtsverkehr bei Vielen als gesellschaftlich
akzeptiert. Ein radikaler Geisteswandel zu den 50ern. Das galt zwar mehr
für die großen Städte als für die ländlichen
Gegenden. Hier – und auch in Vorarlberg - war die Pille immer noch
schwer zu bekommen, manche Frauenärzte weigerten sich, diese zu verschreiben,
da sie um die Moral fürchteten.
Musik: Babysitter-Song (Bill Ramsey)
B
Bravo: Lesung „Der Bravo-Starschnitt“
Barbie
1959 kam in den USA die erste Barbiepuppe auf den Markt. Barbies Vorgängerin
war eine deutsche Pin-up Puppe, die „Bild-Lilli“. Sie war
die erste Puppe der Welt, die erwachsen aussah, aber für Kinder gedacht
war.
Beatles
Die Beatles starteten mit ihren schrägen Pilzfrisuren und dem Hit
“I want to hold your hand” vom Hamburger Starclub aus ihren
Erfolgskurs durch die weite Welt. Bei ihren Konzerten fielen die Teenies
reihenweise in Ohnmacht.
„Pfui, a Beatle!“ Das war der Ausspruch des Vaters meiner
Freundin, wenn aus dem Radio englischsprachige Musik erklang.
Musik: Beatles-Song
C
Coca Cola
Coca Cola wurde zum oppositionellen Statussymbol einer neuen Jugendkultur
und des „american dream“. Konservative wie Kommunisten zogen
in Österreich in den 50er Jahren gegen das neue Getränk zu Felde.
„Eine Person, die Coca-Cola trinkt, fällt auch bald anderen
verderblichen Gewohnheiten anheim“, hieß es. Gerüchte
gingen um, den Konsumenten würden büschelweise die Haare ausfallen.
Doch das Getränk setzte sich trotzdem durch.
Camelia
Werbetext von 1961 mit Bild einer adretten, jungen Frau: „Bewundernswert
gepflegt“ ist diese junge Frau. Mit viel Schönheitssinn hat
sie sich ein eindrucksvolles, heiteres Heim eingerichtet. Ist sie nicht
reizend, diese liebenswürdige Frau, die im Haushalt, im Beruf und
auch in festlichen Stunden immer vergnügt und gepflegt ist? Wie sie
die kritischen Tage immer mit der gleichen Sicherheit und Heiterkeit meistert,
ist das Geheimnis einer kleinen Handtasche. Ein Geheimnis, das nie verraten
wird – die kleine „Camelia- Taschenpackung“ ist ja so
unauffällig“.
Übrigens: Dieses Handtäschchen ist unten beim Verleihpult zu
bewundern.
D
Dralon
Neue, preiswerte und zudem noch pflegeleichte Stoffe aus Kunst- oder Mischfasern
wie Dralon, Perlon oder Trevira kamen auf den Markt. Diese Materialien
und der allmähliche Einzug der Waschmaschinen in die Haushalte bewirkten
im Verlauf des Jahrzehnts einen langsamen Wandel in den Kleidungsgewohnheiten:
Man konnte es sich erlauben, Wäsche und Kleidung häufiger zu
wechseln.
Aus der Werbung:
„Bin ich ein König oder Millionär?“
Eine große Sehnsucht ist jetzt Wirklichkeit. Ich leiste mir täglich
frische Unterwäsche: PERLON! Abends beim Händewaschen geht sie
mir durchs Wasser. Ein bisschen Feinwaschittel tut´s schon. Morgens
fühle ich mich darin wie ein königlicher Millionär!
Meine Herren: Es kommt aufs „unten drunter“ an. Der Mann der
PERLON- Zeit ist auch in Unterhosen....ein Herr!
Musik: „Seemann, deine Heimat ist das Meer“
Dramatisches
Die Revolte von Fußach:
Es dürften an die 20.000 Landsleute gewesen sein, die am 21. November
1964 im Fußacher Hafen zusammenkamen, um gegen Verkehrsminister
Otto Probst zu demonstrieren. Probst überging alle Landeswünsche
nach einer „Vorarlberg“. Er wollte das neue Schiff unbedingt
auf „Karl Renner“ taufen. „Fußach“ machte
Schlagzeilen im In- und Ausland, es beschäftigte monatelang die österreichische
Innenpolitik und wurde schließlich zum Synonym für föderalistischen
Widerstand.
E
Elvis
Elvis Presley war das Idol der amerikanischen und deutschen Jugend. Der
ehemalige Lastwagenfahrer aus Tennessee hatte im Jahr 1956 bereits acht
Millionen Schallplatten verkauft. „Der epileptische Gartenschlauch“,
wie ihn HEUTE im April 1959 nennt, stand bereits seit längerem als
Sündenbock für unbewältigte Jugendprobleme zur Verfügung.
„Eine neue Seuche greift um sich“, urteilt im Oktober 1956
die WIENER ILLUSTRIERTE. Die Jugend sei „außer Rand und Band
geraten“, breche beim Anhören der neuen Musik „in wildes
Grölen und hysterisches Schreien aus“ und werfe sich in wilder
Ekstase zu Boden.
Musik: Elvis-Song anspielen
Einbauküche
Statt der herkömmlichen Wohnküche galt nun die wenige m2 große
Arbeitsküche oder Einbauküche als modern. Einbaumöbel in
genormter Größe wurden einzeilig, zweizeilig oder L-förmig
angeordnet, so dass alle Arbeitsgänge möglichst an einer Wand
konzentriert waren, um der Hausfrau unnötige Wege zu ersparen.
F
Film & Fernsehen
Am Ende der 50er Jahre trat das Fernsehen als neues Massen- und Freizeitmedium
hervor und verdrängte das bis dahin so beliebte Kino. Am 1. Jänner
1957 begann der regelmäßige Fernsehbetrieb in Österreich.
Ende 1959 wurden in Österreich insgesamt 127.402 Fernsehteilnehmer
registriert. Auch hier hatte die Kirche bei der Programmgestaltung einiges
mitzureden. Grundsätzlich sollten alle Programme den Prinzipien einer
„sittlichen Lebensordnung“ entsprechen (z.B. positive Einstellung
zur Familie, keine „triebhaften“ Darstellungen, keine Herabwürdigung
der Ehe).
Lesung: Aus dem Tagebuch der Romy Schneider
Fernweh
In der Trümmerzeit hatte die Fahrt ins Ausland zur größten
Sehnsucht gehört. Nun konnte man sie sich leisten. Eine neue Reiseform
für billig Urlaube kam auf – Camping - Zelten mit Motorroller.
Beliebtes Reiseziel war vor allem Italien.
Musik: „Zwei kleine Italiener“
G
Gummibäume
Gummibäume durften in keinem bürgerlichen Haushalt fehlen. Nebst
Nierentischen und Couchecken waren sie der Inbegriff von Behaglichkeit
und Gemütlichkeit. Siehe Dekoration!
Gummitwist
Gummitwist ist zwar kein Tanz, aber die Beine kann man sich dabei auch
gut verdrehen. Wenn Sie neue Anleitungen dazu suchen: können wir
sie Ihnen aus dem Internet besorgen.
H
Hula-Hoop
In den 50er und 60er Jahren war der Hula –Hoop Reifen sehr beliebt
und fand reißenden Absatz. Seine Produzenten waren in kürzester
Zeit Millionäre. Beim regelmäßigen Gebrauch versprach
die Werbung viele Vorteile: Der Reifen mache den Organismus gelenkig,
setze das Gewicht herab und verscheuche schlechte Laune. Es gab regelrechte
Wettbewerbe; der 19 jährige John Filmens stellte einen Zeitrekord
mit 10 Stunden und 10 Minuten auf. Francis Elmen bewegte vierzehn Ringe
gleichzeitig, und die 11 jährige Mary May hielt mit 18.000 Umdrehungen
in 3 Stunden und 30 Minuten den Schnelligkeitsrekord.
Halbstarke
In den 50er Jahren entstand eine neue Jugend-Subkultur, die sogenannten
„Halbstarken“. Die Gallionsfiguren dieser Gruppe waren James
Dean „denn sie wissen nicht was sie tun“ und Marlon Brando
„der Wilde“. Wie ihre Idole kleideten sich die Jugendlichen
in schwarze Lederjacken und Jeans. Die Schmalzlocke und die Zigarette
im Mundwinkel durften natürlich nicht fehlen. Als Parade-Halbstarker
des deutschen Films galt Horst Buchholz.
Lesung: Ulrich Plenzdorf: Blue Jeans
Musik: „Ich will nen Cowboy als Mann!“
I
Ilg
Aus dem Buch “Meine Lebenserinnerungen” von Landeshauptmann
Ulrich Ilg: “Man hat natürlich Enttäuschungen erlebt.
Wie oft habe ich auf Versammlungen appelliert, die Gesinnungsfreunde möchten
aus Treue und Anhänglichkeit zur Partei die eigene Presse, das Volksblatt
abonnieren. Die Wirkung meiner Werbung war leider immer ergebnislos. Das
ist die größte Enttäuschung gewesen, die ich erlebt habe“.
J
Jazz
Nach der Unterdrückung des Jazz im nationalsozialistischen Deutschland
setzte er sich in den 50er Jahren im deutschsprachigen Raum als Musikform
durch. Jazz-Fans organisierten sich in sogenannten Hot Clubs und veranstalteten
Jamsessions, Konzerte und Plattenabende.
Jugendschutz
Am 1. November 1964 trat das erste Vorarlberger Jugendschutzgesetz in
Kraft. Die Notwendigkeit für die Schaffung dieses Gesetzes wurde
damit begründet, dass die „heutige Jugend“ „gefährdeter,
labiler, Umwelteinflüssen stärker preisgegeben und schutzloser“
wäre als „in früheren Zeiten“.
„Man denke an die negativen Folgen der ständigen Schrift-,
Bild- und Toneinwirkungen, wie sensationelle und erotisierende Schriften
(Illustrierte), Filmbesuch und Fernsehen (Starkult), Radio und Musikautomaten
(Schlager, heiße Musik), an die diversen Produkte der Vergnügungsindustrie,
die künstlich Bedürfnisse wecken, an den vorzeitigen Genuß
von Zigaretten und Alkohol sowie an das sexuelle Früherlebnis“.
Gewarnt wurde vor allem vor dem Besuch von Filmvorführungen. Filme
unterlagen einer strengen Zensur und wurden teilweise auch verboten„“die
Sexwoge sollte sich nicht über „den einzelnen und über
die ganze Familie“ ergießen.
Um die Jugendlichen zum Sparen zu bringen, war die Behörde z.B.
berechtigt „unter gewissen Voraussetzungen einen Teil des Lohnes
bis zur Erreichung der Volljährigkeit auf ein Sparkonto zu legen“,
um so „bessernd auf die Jugend einzuwirken“.
K
Kofferradio
Das neue Kofferradio wurde „Frohsinn“ genannt. 1954 feierte
der österreichische Rundfunk seinen 30. Geburtstag und vermeldete
1.735.584 Teilnehmer.
Kriminal-Tango / Musik: Kriminal-Tango
L
Langhaarige
Die Beat-Kultur mit ihrem Pilzkopf, dem Mini und der Unisexmode war auch
ein Ausdruck „subversiver Gefühle“. Während die
Mädchen um jeden Zentimeter Rocklänge kämpften, kämpften
die jungen Männer um jeden Millimeter Haarlänge. Das Tragen
langer Haare war nicht nur ein Modetrend, sondern auch ein Zeichen von
Unangepasstheit und Rebellion.
Aus einem Leserbrief 1967: “Unsere Soldaten sind der Ansicht, dass
die Pilzkopfmähnen nicht nur gewaschen, sondern auch geschoren werden
müssen“.
Lederjacken
Mick Farren beschreibt seine erste Begegnung mit der schwarzen Jacke:“
Ich wand mich in das hinein, was mein erstes cooles Kleidungsstück
werden sollte. Es war das Bronx-Modell. Ich traute meinen Augen nicht,
ich sah so cool aus. Meine Beine wirkten länger und meine Schultern
breiter. Ich war eine Kreuzung zwischen Elvis und Lord Byron..“.
M
Mini
Die Engländerin Mary Quant führte 1962 den Minirock in die Welt
der Mode ein. Die neue Länge setzte sich durch, der Mini-Rock wurde
zum Modeschlager auf der ganzen Welt. Sogar das englische Königshaus
räumte eine Kleiderlänge von exakt sieben Zentimetern oberhalb
der Kniemitte ein. Nur der Vatikan verbot die neue „unzüchtige“
Kleidung.
N
Nitribitt
Rosemarie Nitribitt gilt als Deutschlands berühmteste Prostituierte,
als erstes sündiges Symbol des deutschen Wirtschaftswunders. Die
Edelhure fuhr mit ihrem feuerroten Cabrio durch die Straßen und
trank mit ihren Kolleginnen Champagner. Nitribitt wurde 1957 mit einem
Nylonstrumpf erwürgt in ihrer Wohnung aufgefunden. Ihr Tod entwickelte
sich zum
1. Gesellschaftsskandal der BRD.
Musik: „This lady is a tramp“
O
Oswalt Kolle & Ordentliches
Oswalt Kolle machte es sich mit missionarischem Eifer zur Aufgabe, mehr
Spaß in die Schlafzimmer zu bringen. Mit Filmen wie „Das Wunder
der Liebe – Sexualität in der Ehe“, „Deine Frau,
das unbekannte Wesen“ oder „Dein Mann, das unbekannte Wesen“
widmete er sich der Aufklärung. Und er wurde damit zum Volkshelden.
Über Sexualität zu sprechen war plötzlich Zeitgeist.
Ordentliches
Lesung: Aus der Biographie von Johanna Dohnal
Ohrwurm
Musik
P
Petticoat
Ob gepunktet oder gestreift oder mit Blümchen: Der knielange Petticoat
mit den vielen gestärkten Unterröcken war in den 50er Jahren
das absolute „must“ und durfte vor allem beim Rock´n´Roll
tanzen nicht fehlen.
Plattenspieler
1960 besaß jeder dritte deutsche Haushalt einen Plattenspieler und
nur jeder sechste verfügte über ein Bad.
Q
Quinn
1956 erreichte der Boom der Heimat- und Fernwehschlager mit „Heimweh“
von Freddy Quinn, eigentlich Manfred Nidl-Petz, seinen Höhepunkt.
Dieser Schlager war für den 1931 in Wien geborenen Sänger der
erste große Erfolg. Freddys Erfolg hing vor allem mit dem hohen
Maß an Glaubwürdigkeit zusammen, die der bei Jung und Alt gleichermaßen
beliebte Interpret vermittelte. Seine Lieder handelten von „Sehnsucht“,
„Heimweh“ und „Einsamkeit“ und trafen den Nerv
der Zeit. Seine Biographie bot den Hintergrund für das Image des
heimatlosen, gitarrespielenden und singenden Seemans. „Du brauchst
doch immer wieder einen Freund“ - so der Text seines Werbeplakates.
Musik: „Die Gitarre und das Meer“
R
Rock´n´Roll
Dass Rock´n´Roll Slang-Ausdruck für „Beischlaf“
ist, „Schaukeln, Wälzen“ oder ähnliches bedeutet,
war hierzulande kaum bekannt. Gott sei Dank. Aufregung gab´s auch
so genug. 1959 berichtete die WIENER ILLUSTRIERTE unter Berufung auf neue
wissenschaftliche Erkenntnisse:
„Sorgfältige Untersuchungen“ erbrachten nämlich
empirisch „den Beweis“, „dass die Rock´n´Roll
Tänzer zu 95% und oftmals sogar zu 99% vollkommen normale Menschen“
oder, wie es in dem Bericht auch heißt, „achtbare junge Bürger“
seien, „die sich wieder ganz sachlich und vernünftig benahmen,
sobald sie auf ihre Plätze, an ihren Tisch, zurückgekehrt waren“.
Musik: einige Takte Rock 'n’ Roll
Roller
Der Lohner-Roller war der Traum vieler Teenager und Twens, nur leider
für die meisten unerschwinglich. Ein Roller kostete damals ein kleines
Vermögen.
Die Alternative war manchmal: Bauplatz kaufen oder doch lieber den Roller?
S
Strumpfhose
Der Strapsenapparat, obwohl vor 70 Jahren als Gesundheitsformwäsche
eingeführt, war spätestens nach der Einführung des Minirocks
undenkbar geworden. Er verhinderte gerade jene Bewegungsfreiheit, die
der Mini gewähren sollte. Die neu entworfene Strumpfhose, eigentlich
eine typische Schreibtischkonstruktion, fand sofort reißenden Absatz.
T
Twist
Die 60er Jahre bringen eine neue Jugendkultur, neue Musik, neue Stars.
Es wird Twist getanzt. Viele Erwachsene nannten diesen Tanz „obszön“
und sogar „gesundheitsschädlich“. In Vorarlberg wurde
1962 mit Berufung auf Paragraph 5 des Gesetzes über die Abhaltungen
von öffentlichen Veranstaltungen aus dem Jahre 1929 der „Twist“
verboten, da er zu den Tänzen zählt, „die das Sittlichkeitsgefühl
verletzen“.
Musik: einige Takte Twist
Twiggy
Das englische Modell Twiggy („Zweiglein“) alias Leslie Hornby
war das bekannteste Fotomodell ihrer Zeit. 1966 wurde sie „zur teuersten
Bohnenstange der Welt“ erklärt. Sie verkörperte eine neue
Weiblichkeit, die sich vom vollen gerundeten Schönheitsideal der
50er Jahre distanzierte. In waren jetzt vorpubertäre Jugendlichkeit,
kleine Brüste und ein zarter, zerbrechlicher Körperbau. Viele
Teenager versuchten damals zu hungern und die „Idealmaße“
von Twiggy 78-55-80 zu erreichen. Im Vergleich damals: Brigitte Bardot
93-50-85.
U
Ungehöriges
Mit dem Aufkommen des Films beschloss der Vorarlberger Landtag im Jahre
1928 ein Lichtspielgesetz, dessen Vollzug in den 60er Jahren immer wieder
für Österreichweites Aufsehen sorgte. So wurden Filme verboten,
die anderswo Prädikate erhielten, wie etwa 1964 „Irma la Douce“
und ein Jahr später „Der Reigen“ von Arthur Schnitzler.
Vorarlberger Jugendliche sahen sie trotzdem – in Lindau.
Lesung: Aus der Autobiographie von Petra Schürmann
V
Verliebtes
1956 erscheint erstmals die Jugendzeitschrift „Bravo“ des
Münchener Kindler-Verlages. Diese Zeitung bot schon damals Rat und
Hilfe für Jugendliche zum Thema Liebe und Sexualität an. Dass
es die Teenager auch damals nicht leicht hatten, beweist folgender Leserbrief
zum Thema: „Sie wollen mehr als nur Küsse! Der gefährliche
Heimweg nach dem Tanzabend.“
Liebes Bravo,
Heute möchte ich Dir endlich meine Frage, welche mir schon lange
am Herzen liegt, schreiben.
Ich nehme an, dass viele Mädchen schon vor einem solchen Problem
gestanden haben, aber keine sich recht traut, es zu veröffentlichen.
Meine Freundin und ich sind 17 Jahre. Im letzten Jahr haben meine Freundin
und ich uns schon oft von Jungs nach Hause bringen lassen, mit denen wir
zum Beispiel schon einige Male getanzt hatten und von denen wir auch einen
netten Eindruck hatten. Unterwegs, manchmal im Wagen, wollten sie uns
gleich küssen. Wir weigerten uns dann natürlich, konnten uns
aber zuletzt nicht mehr durchsetzen. Sollen wir uns eigentlich schon einen
harmlosen Kuss gefallen lassen?
Sind wir dann kurz vor unserem Haus angelangt, wollen sie, dass wir uns
ihnen ganz hingeben. Was wir noch nie getan haben. Natürlich machen
die Jungs uns dann Vorwürfe, z.B. wir hätten sie nicht gern
und wir wären die einzigen, die es nicht täten. Aber das glauben
wir nicht.
Manchmal wissen wir wirklich nicht, wie das noch weitergehen soll und
sind ganz verzweifelt. Die meisten Jungs konnten wir zudem auch noch gut
leiden, aber sie guckten uns nicht mehr an. Ist so etwas denn die „heutige
Mode“? Wir wissen es nicht. Gib Du uns einen guten Ratschlag, wie
wir uns verhalten sollen.
Sind heute denn fast alle Jungs so? Oder gibt es auch noch andere? Meistens
ist es so, dass wir gerade solche am liebsten leiden mögen.
Zwei verzweifelte Bravo-Leserinnen
Musik: „Liebeskummer lohnt sich nicht my darling“
W
Winterspiele
Medaillengewinner Herren Olympische Winterspiele 1956:
Abfahrtslauf Toni Sailer Gold
Spezialslalom Toni Sailer Gold
Riesenslalom Toni Sailer Gold
Wurzlitzer
1954 greift die „Wurlitzer“ Welle auf Österreich über.
1957 wandern 144 Millionen Schilling in derartige Musikautomaten, was
etwa 890 Einfamilienhäusern entspricht. Ausgaben, die durch die im
März desselben Jahres eingeführten silbernen Zehnermünzen
mit Goldhaubenmotiv noch erleichtert wurden.
X
XY ungelöst
Am 20. Oktober 1967 wurde die erste Sendung „Aktenzeichen XY...ungelöst“
mit Eduard Zimmermann ausgestrahlt.
Z
Zeitschriften
Die aktuellsten Zeitschriften waren damals die Wiener Bildwoche, die Wiener
Illustrierte oder die Große Österreich Illustrierte. Sie enthielten
ca. 20 Blätter, der Aktualitätsgehalt war meistens gering, Bilder
und Berichte vielfach austauschbar. In den Gasthäusern lagen meist
veraltete Exemplare auf. Erst mit Einführung des Lesezirkelabonnements
verkürzte sich der Aktualitätsrückstand auf 3 Wochen bis
vierzehn Tage. Das Blatt der Hausfrau gab praktische Tipps: etwa „wie
macht das Arbeiten Spaß“ und es stellte eine „Besengymnastik“
vor.
Lesung aus den „Vorarlberger Nachrichten“: „Fußbodenreinigen
leicht gemacht“
|